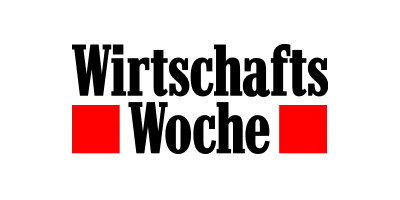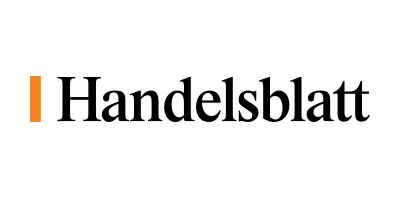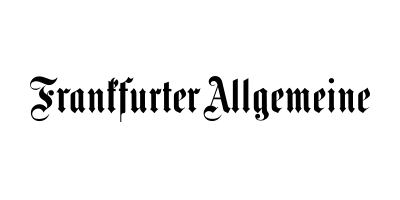Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 31. Juli 2025 (Az. I ZR 90/23) seine Stellungnahme zum Vorabentscheidungsersuchen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, C-530/24) veröffentlicht. Im Fokus steht die Frage, ob Spieler ihre Verluste aus Online-Sportwetten zurückverlangen können – und ob das frühere deutsche Konzessionssystem mit dem Unionsrecht vereinbar war.
Hintergrund des Verfahrens
Ein Kläger fordert von einem Wettanbieter die Rückzahlung verlorener Einsätze in Höhe von 3.719,26 Euro. Grundlage seiner Klage sind sowohl bereicherungsrechtliche (§ 812 BGB) als auch deliktsrechtliche (§ 823 Abs. 2 BGB) Ansprüche. Nach seiner Auffassung seien die Wettverträge gemäß § 134 BGB nichtig, da sie gegen das Verbot unerlaubter Internetwetten (§ 4 Abs. 4 GlüStV 2012) verstoßen hätten.
Das Konzessionssystem und unionsrechtliche Bedenken
Die beklagte Betreiberin nahm am ursprünglichen Konzessionsverfahren teil, das 2016 vom Verwaltungsgericht Wiesbaden für rechtswidrig erklärt wurde. Grund: mangelnde Transparenz, diskriminierende Auswahlkriterien und eine nicht nachvollziehbare Begrenzung auf 20 Lizenzen. Das Gericht sah darin zugleich einen Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV. Das Berufungsverfahren vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof ruht bis heute, sodass keine endgültige Entscheidung vorliegt.
Rechtslage seit 2020
Mit dem Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag entfiel die Begrenzung der Konzessionen. Künftig sollte jeder Anbieter eine Erlaubnis erhalten, der die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Auf dieser Grundlage erhielt die Beklagte im Jahr 2020 eine bundesweite Genehmigung für Sportwetten und Online-Wetten.
Bedeutung der BGH-Stellungnahme
Der BGH stellt klar, dass sich die Klage nicht nur auf Bereicherungsrecht, sondern auch auf deliktsrechtliche Vorschriften stützt. Zudem könne die unionsrechtliche Bewertung des früheren Konzessionssystems weiterhin ausschlaggebend sein – auch wenn inzwischen eine Lizenz vorliegt. Der EuGH soll prüfen,
- ob Verträge aus der Zeit vor Lizenzerteilung gültig waren,
- ob die damalige Begrenzung auf 20 Lizenzen mit EU-Recht vereinbar war
- und welche Folgen sich daraus für mögliche Rückforderungsansprüche ergeben.
Ausblick
Die Antwort des EuGH in der Rechtssache C-530/24 wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche laufende Verfahren in Deutschland haben. Sie betrifft sowohl die Frage der Rückforderbarkeit von Spielverlusten als auch die zukünftige Ausgestaltung der Glücksspielregulierung.
👉 Das Verfahren hat daher große Bedeutung – sowohl für betroffene Spieler als auch für Anbieter und den Verbraucherschutz im Bereich des Online-Glücksspiels.